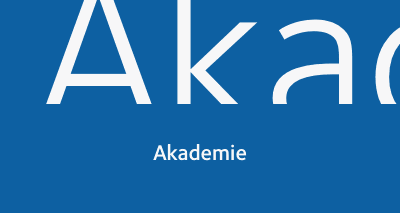Den Nächsten sehen in einer gewaltvollen Welt
Sommerpredigt von Friederike Krippner zu Psalm 139
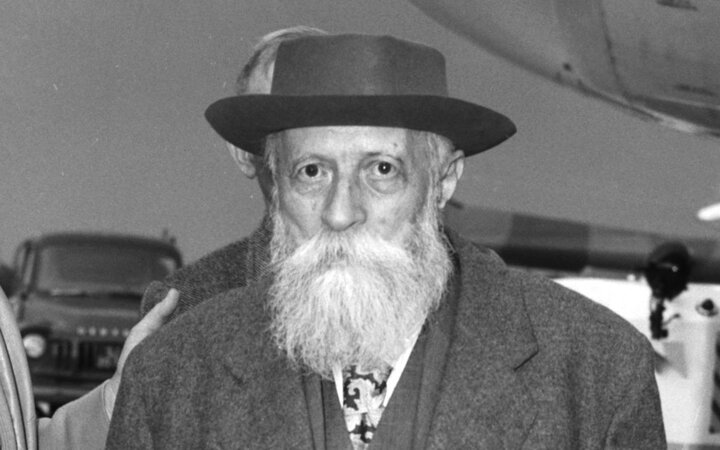
© Joop van Bilsen, for Anefo / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Martin Buber
In ihrer Sommerpredigt hat Akademiedirektorin Friederike Krippner Psalm 139 in der Übersetzung Martin Bubers beleuchtet. Darin werde die Überzeugung von Gott als Gegenüber deutlich, dem wir uns immer wieder anvertrauen dürfen, so Krippner. Davon abgeleitet sollten wir auch unseren Mitmenschen in echtem Dialog begegnen.
Die Predigt hielt Krippner in der Maria-Magdalenen-Kirche Eberswalde beim Sommerausflug des Freundeskreises der Evangelischen Akademie zu Berlin. Im Folgenden dokumentieren wir sie in leicht bearbeiteter Form.
(…) DU, du erforschest mich und du kennst,
du selber kennst mein Sitzen, mein Stehn, du merkst auf mein Denken von fern,
meinen Pfad und meine Rast sichtest du, in all meinen Wegen bist du bewandert.
(Psalm 139,1-3)
Das ist der Beginn des Psalm 139, den David singt, in einer ungewohnten Übersetzung: Es ist die Übersetzung “Die Schrift“ des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, die er gemeinsam mit dem jüdischen Historiker und Philosophen Frank Rosenzweig begonnen hat. Zusammen wollten sie die hebräische Bibel – den Tanach – von Grund auf neu übersetzen. 1926 haben die beiden damit begonnen. Drei Jahre später aber starb Rosenzweig und Buber setzte das Projekt alleine fort. Er schloss es 1938 ab, dem Jahr, in dem ihm – gerade noch– die Flucht vor den Nationalsozialisten gelang. Er selbst hat diese Flucht immer als „Einreise nach Jerusalem“ bezeichnet. In Jerusalem hat Buber „Die Schrift“ noch einmal überarbeitet, immer dem Ursprungsziel folgend, das er mit Rosenzweig hatte. Und dieses Ziel war, eine deutsche Übersetzung zu schaffen, die möglichst nah am hebräischen Text ist: in Wort, Sinn, Sprachduktus und Gliederung. Buber und Rosenzweig wollten den Leserinnen und Lesern, die nicht Hebräisch, wohl aber Deutsch können, gleichsam ein hebräisches Hörerlebnis vergönnen – und zwar wirklich eher ein Vorlese- und Hörerlebnis denn ein Leise-Lese-Erlebnis. Ganz nah an der jüdischen Tradition, im Zentrum deren Religionspraxis ja auch das laute Lesen der biblischen Texte steht. Das alles geht allerdings zu Lasten der Verständlichkeit – aber zusammen gehen wir nun doch guten Mutes durch den Text.
Dass ich mit Ihnen gemeinsam in diese besondere Übersetzung schauen möchte, ist aber keine intellektuelle Spielerei, sondern weil ich meine, dass der Sinn, die Schönheit, aber auch die Widerständigkeit dieses Psalm 139, den viele als eines der schönsten Gebete der Bibel beschreiben, in dieser Übersetzung besonders prägnant wird. Drei Punkte möchte ich dabei mit Ihnen betrachten. Es wird gehen um das „Du“, um „Geheimnisse“ und um das „Politische“.
Das „Du“
„DU, du erforschest mich und du kennst, / du selber kennst mein Sitzen, mein Stehn …“
Noch bevor er sich an die Übersetzung des Tanachs wagte, hat Martin Buber ein Buch geschrieben, das später als sein Hauptwerk rezipiert worden ist: „Ich und Du“ (1923). Ähnlich wie Bubers und Rosenzweigs Tanach-Übersetzung zeichnet sich auch „Ich und Du“ nicht gerade durch leichte Lesbarkeit aus. Aber der Kern dieses Büchleins ist so einfach und bestechend wie folgenreich für die Sicht auf unser Verhältnis zur Welt, zu anderen Menschen und zu Gott.
Ganz knapp gesagt, kennt Buber zwei Möglichkeiten, wie Menschen sich die Welt erschließen: als Verhältnis zwischen Ich und Es und als Verhältnis zwischen Ich und Du. Im Verhältnis von Ich und Es wird die Welt zur Erfahrung. Das Es ist ein Objekt, das erfahren wird und benutzt werden kann: Es ist ein Verhältnis des Nebeneinanders.
Ganz anders ist es mit dem Ich und dem Du. Das Ich, so Buber, kann sich selbst wahrhaft nur in einem Gegenüber zu einem Du entfalten. Ich und Du, das ist Dialog pur. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, das ist ein vielzitierter Satz aus dem Buch. Und mit Begegnung ist hier kein: „Hi, wie geht’s?“ gemeint, bei dem ich schnell weitergehe; kein: „Ja erzähl doch mal, wie es Dir geht“ während die Gesprächspartnerin heimlich aufs Handy schielt. Vielmehr geht es darum, dass ich mich mit meinem Gegenüber auseinandersetze, dass ich ihn oder sie direkt anspreche, und dass dieses Gegenüber, dieses Du, mir ebenso etwas rückmeldet. Das gelingt nur dann, wenn wir bereit sind, andere als vollständige Individuen anzusehen und anzusprechen. Wenn wir uns das Nebeneinander verschiedener sogenannter Blasen heute anschauen, dann leuchtet das zumindest mir unmittelbar ein: dass wir einander und uns verlieren, wenn wir nicht mehr in echten Dialog miteinander treten.
Auch die Liebe ist für Buber etwas grundsätzlich Dialogisches. Sie haftet uns Menschen nicht einseitig an, sondern sie entsteht erst zwischen dem Ich und dem Du. Das gilt für die Liebe zwischen Menschen, aber auch und ganz besonders für das Verhältnis des Menschen zu Gott. Auch dieses ist für Buber gekennzeichnet durch ein Verhältnis von Ansprache, von Dialog zwischen Ich und Du, von dem Engagement daher auch, sich Gott zuzuwenden, sich wahrhaft zuwenden zu wollen. Dass wir Gott als Du ansprechen dürfen, nicht als JHWH, nicht als distanzierendes und ehrfürchtiges HERR, sondern als „Du“: Darin liegt die Möglichkeit, Gott zu erfahren, darin liegt die Möglichkeit, in ein echtes Verhältnis zu Gott zu treten, darin liegt die Möglichkeit, Gottes Liebe zu erfahren. Martin Buber, dieser Buber, der Zeitzeuge des Holocaust war, der den Nazis nur knapp entrinnen konnte, hat das selbst einmal so ausgedrückt:
„Gewiß, sie zeichnen Fratzen und schreiben 'Gott' darunter, sie morden und sagen 'im Namen Gottes'. Aber wenn aller Wahn und Trug zerfällt, wenn sie ihm gegenüberstehen im einsamsten Dunkel und nicht mehr 'Er, Er', sagen sondern 'Du, Du' seufzen, 'Du' schreien, sie alle das Eine, und wenn sie dann hinfügen 'Gott', ist es nicht eben doch doch der wirkliche Gott, den sie alle anrufen, der Eine Lebendige, der Gott der Menschenkinder?! Ist nicht er es, der sie hört? Der sie – erhört?“ (Karl-Josef Kuschel: Martin Buber. Seine Herausforderung an das Christentum, Gütersloh 2015, S.155)
„DU, du erforschest mich und du kennst, / du selber kennst mein Sitzen, mein Stehn …“ – ein Gottes-Du, in dem sich das David-Ich wahrhaft gesehen und erkannt fühlen darf.
Geheimnisse
Aber wie das so ist, wenn man wahrhaft gesehen wird: völlig ohne Ambivalenzen ist das nicht. Ungefähr 13 Geheimnisse hat jeder Mensch, jeder und jede von uns also. Und fünf davon teilen wir mit niemanden, die nehmen wir mit ins Grab, so zumindest laut Forschungen des Teams rund um den Columbia-University-Professor Michael Slepian. (Vgl. SZ-Magazin vom 2. Mai 2025.) Also fünf Geheimnisse teilen wir so richtig mit niemanden: nicht mit unserem besten Freund und auch nicht mit unserer Ehefrau. Denken Sie mal kurz nach: Auf wie viele Geheimnisse kommen Sie? – Und dann denken Sie nochmal weiter: Teilen Sie diese fünf Geheimnisse mit Gott?
In unserer Buber-Übersetzung des Psalms heißt es:
Ja, kein Raunen ist mir auf der Zunge, da, schon erkannt, DU, hast dus allsamt.
Hinten, vorn engst du mich ein, legst auf mich deine Faust.
Zu sonderlich ist mir das Erkennen, zu steil ists, ich übermags nicht.
Wohin soll ich gehn vor deinem Geist, wohin vor deinem Antlitz entlaufen!
Ob ich den Himmel erklömme, du bist dort, bettete ich mir das Gruftreich, da bist du.
Erhübe ich Flügel des Morgenrots, nähme Wohnung am hintersten Meer,
dort auch griffe mich deine Hand, deine Rechte faßte mich an. (Psalm 139, 4-10)
Hier ist er, der allwissende Gott, der Gott, der alles sieht und uns wahrhaft erkennt. Das ist nicht nur ein heimeliger Gedanke: „Hinten, vorn engst du mich ein, legst auf mich deine Faust“. Wir selbst können das nicht, uns so erkennen: „Zu sonderlich ist mir das Erkennen, zu steil ists, ich übermags nicht.“ Und es gibt kein Entkommen vor Gottes Allwissenheit: „Wohin soll ich gehn vor deinem Geist, wohin vor deinem Antlitz entlaufen! / Ob ich den Himmel erklömme, du bist dort, bettete ich mir das Gruftreich, da bist du.“ Die Gewissheit, dass Gott uns mehr erkennt als wir uns selbst erkennen können, ist mindestens verwirrend. Die Erkenntnis, dass wir seinem wissenden Blick nicht entkommen, vielleicht auch beklemmend.
Denn warum haben wir Geheimnisse? Forscher unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Geheimnissen. Es gibt ganz pragmatische, harmlose Geheimnisse. Unsere Pin-Nummer zum Beispiel. Es gibt Geheimnisse, die schweißen uns als Gruppe zusammen: Weil kaum etwas so viel Nähe bringt, wie wenn sich mir jemand exklusiv anvertraut: „Dir, nur Dir sage ich, ganz im Vertrauen, dass ich mich verliebt habe, in diese eine Person, psst, aber nicht weitersagen“ – das verbindet mit 14 Jahren genauso wie mit 65. Aber dann gibt es auch dunkle Geheimnisse, zum Beispiel Eheleute, die erst von der Spielsucht ihres Partners erfahren, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.
Aber es muss gar nicht so dramatisch sein: Jede und jeder von uns hat sie, kleine Geheimnisse, die wir niemanden anvertrauen, weil wir fürchten, unser Gegenüber sähe uns dann nicht mehr so, wie wir gesehen werden wollen, oder weil wir einen Konflikt fürchten, wenn jemand dies eine von uns wüsste.
Die Krux mit solchen Geheimnissen ist indes, so haben Slepian und andere Forscherinnen und Forscher herausgefunden: Solche Geheimnisse belasten uns. Immer wieder denken wir an sie. Sie sind nicht da und gerade darum da; sie kommen an die Oberfläche; sie schmuggeln sich in unsere Gedanken und können eine unsichtbare Mauer zwischen uns und unseren Lieben hochziehen. Und wenn wir dann noch einmal Bubers These hinzunehmen, die These, dass wir uns erst im Gegenüber wirklich erfahren können, in der Begegnung, dann wird noch deutlicher, wie belastend Geheimnisse sein können.
Aber mit Gott ist das anders. Darum geht es hier. Denn vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Und so beängstigend das ist, dieses Gesehenwerden, so sehr es unser Vorstellungsvermögen übersteigt, so tröstlich und schön ist es dann eben doch, ganz und gar gesehen zu werden. David, unser David, der diesen Psalm zu Gott singt, geht sogar noch weiter:
Ja, du bists, der bereitete meine Nieren, mich wob im Leib meiner Mutter!
Danken will ich dir dafür, daß ich furchtbar bin ausgesondert: sonderlich ist, was du machst, sehr erkennts meine Seele.
Mein Kern war dir nicht verhohlen, als ich wurde gemacht im Verborgnen, buntgewirkt im untersten Erdreich,
meinen Knäul sahn deine Augen, und in dein Buch waren all sie geschrieben, die Tage, die einst würden gebildet, als aber war
nicht einer von ihnen.Und mir wie köstlich, Gottherr, sind deine Gedanken, ihre Hauptstücke wie kernkräftig!
ich will sie buchen, ihrer wird mehr als des Sands! – Ich erwache: noch bin ich bei dir. (Psalm 139, 13-18)
Was vorher noch auch beklemmend war – „Hinten, vorn engst du mich ein, legst auf mich deine Faust“ – das wird nun endgültig zum Trost. Die Gewissheit, dass Gott uns erschaffen hat, dass er nicht nur alles weiß, sondern auch vorhergesehen hat, diese Gewissheit ist Befreiung. Der vermeintliche Widerspruch von Freiheitsstreben und dem Wunsch nach Lenkung löst sich auf, weil in Gottes Lenkung die Selbsterkenntnis gelingen kann: „Und mir wie köstlich, Gottherr, sind deine Gedanken, ihre Hauptstücke wie kernkräftig!“ Dass wir vor Gott keine Geheimnisse haben können, heißt auch, dass wir uns nicht verstellen müssen – welche Erleichterung, welche Geborgenheit!
Das „Politische“
Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Geborgenheit. Zumindest auf den ersten Blick:
O daß du, Gott, umbrächtest den Frevler: »Ihr Blutmänner, weichet von mir!«,
sie, die dich zu Ränken besprechen, es hinheben auf das Wahnhafte, deine Gegner!
Hasse ich deine Hasser nicht, DU, widerts mich der dir Aufständischen nicht?
ich hasse sie mit der Allheit des Hasses, mir zu Feinden sind sie geworden. (Psalm 139, 19-22)
Oft ist das als gewisser Bruch zur vorherigen Poetik des Textes gelesen worden. Auf einmal ist von Hass die Rede. Bei der Übersetzung von Buber ist das aber gar nicht ganz so drastisch. Denn diese Übersetzung betont schon vorher das Beängstigende von Gottes Allwissenheit. Und trotzdem kommt nun hier ein weiterer Aspekt dazu. Der Einbruch des Realen, in einer ganz unmittelbaren Brutalität: „O daß du, Gott, umbrächtest den Frevler.“
Wenn Menschen von Gott abfallen, dann entfaltet sich Gewalt, werden Menschen zu „Blutmännern“. Die Bibel weiß sehr gut, wozu Menschen fähig sind. Nach der Vertreibung aus dem Paradies erschlägt Kain Abel. Und es geht ähnlich weiter: Kriege, Mord, Vergewaltigung – all das kennt die Bibel. Wir leben in der unerlösten Welt. Darum geht es hier.
Diese unsere Welt verlangt danach, dass wir in ein Verhältnis zu ihr treten. Dieses Verhältnis sollte im besten Fall von unserem Verhältnis zu Gott geprägt sein. Gewalt ist aber immer eine Abkehr von Gott, weil es dann nicht mehr gelingt, im Gegenüber den Nächsten zu sehen. Kein Du mehr, sondern nur noch ein Es.
Dagegen wendet sich David. Er schlägt sich stattdessen ganz auf die Seite Gottes. Auch seinen Hass, den er in der unerlösten Welt empfindet, gibt er dabei in Gottes Hände:
Erforsche, Gottherr, mich, kenne mein Herz, prüfe mich, kenne meine Sorgen,
sieh, ob bei mir Weg der Trübung ist, und leite mich auf dem Wege der Weltzeit! (Psalm 139, 23-24)
Gottes Leitung als Sehnsucht. Gott als Gegenüber, dem wir uns immer wieder anvertrauen dürfen, in dem wir uns erkennen können. Und davon abgeleitet: Unser Mitmensch als Du, dem wir in echtem Dialog begegnen können. Das Leben als Begegnung. Den Mut, diesen Glauben auch in Handeln umzusetzen. Den Nächsten zu sehen in einer gewaltvollen Welt. Das gibt uns Psalm 139 in der Übersetzung von Buber und Rosenzweig mit. Ich hoffe, auch Sie können all das mitnehmen, in ihre Gebete, in ihren Tag, in die nächste Woche.
Erschienen am 16.07.2025
Aktualisiert am 31.07.2025