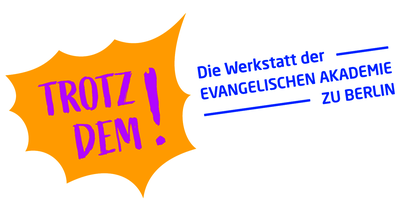Die Stadt als Ort politischen Lernens
Provokationen, Enthüllungen und Methoden

© Hannah Schilling/EAzB
Urbanität ist charakterisiert durch Differenz, Anonymität und flüchtige Begegnungen, gebaute Umwelt und umkämpfte Ordnung. Was können wir beim Erkunden der Stadt lernen?
Eine Gruppe steht im Eingangsportal der Deutschen Bank und spielt „1,2, oder 3“. Die Wände sind glatt, glänzend, die hohen Türen imposant, aber verschlossen. Bei der Gruppe handelt es sich um Multiplikator*innen der politischen Bildung, die drei Tage lang erkunden, wie methodisch vielfältig der städtische (semi-)öffentliche Raum als Ort des politischen Lernens genutzt werden kann. Während die Leitung des Stadtrundgangs Klimakiller Berlin Mitte ihnen hier Quizfragen zu Einschätzungen von Energieprojekten auf dem afrikanischen Kontinent stellt, ernten sie strenge Blicke eines Wachmanns, der den Eingang des Bankgebäudes kontrolliert. Wir sind hier nicht erwünscht. Nach ein paar Minuten ist der Geduldsfaden des Wachpersonals ausgereizt, und wir müssen das Gebäude verlassen.
Was zeigen uns Städte? Urbanität ist charakterisiert von Differenz, Anonymität und flüchtigen Begegnungen, gebauter Umwelt und umkämpfter Ordnung. Was können wir lernen beim Erkunden der Stadt? Das Seminar Politisches Lernen im Stadtraum fand im Mai in Berlin als Kooperation der Evangelischen Akademie zu Berlin, der Evangelischen Akademie Hofgeismar und der Berliner Landeszentrale für politische Bildung statt.
Was provoziert die Stadt?
Als sozialer Raum, der mehr als andere Räume von Heterogenität und Dichte gekennzeichnet ist, konfrontieren Städte uns mit Differenz. Ungefragt und wenig kontrollierbar treffen wir auf Verhaltensweisen, Lebensstile, Ästhetiken, die sich von jenen unterscheiden, mit denen wir vertraut sind, die uns ähneln und unserer Lebensweise entsprechen. Diese Differenzerfahrung ist ein vielversprechender Ausgangspunkt, um sich mit Fragen gesellschaftlichen Zusammenlebens auseinanderzusetzen und seine Normen, Regeln und Machtstrukturen nicht nur abstrakt, sondern konkret zu beobachten und emotional zu erfahren.
Der Diskussion mit den Teilnehmenden folgend, betrifft dies insbesondere auch die Frage nach freier Entfaltung von individuellen Bedürfnissen und das Potenzial für Anerkennung der eigenen Identität, Denn städtische Räume können gesellschaftliche Minderheiten zusammenbringen, die in weniger besiedelten und kleineren Sozialräumen noch isolierter wären.
Urbaner Raum und städtische Orte eignen sich für politisches Lernen, weil hier in konkreten (Lebens-) Situationen, anhand spezifischer, greifbarer Problemlagen und in realen Konflikten das Politische erfahrbar werden kann (vgl. JoDiDD 2024). Macht wird räumlich greifbar, wenn wir in glatten Eingangshallen ganz konkret und real erleben, dass es unsichtbare Barrieren, verschlossene Türen und einschüchternde Architektur gibt.
Durch das Eintauchen in städtische Räume, durch die Interaktion mit den Menschen, Dingen, räumlichen Arrangements vor Ort können Menschen darin gestärkt werden, sich selbst und die Welt zu verstehen – auf rationaler, aber vor allem auch emotionaler Ebene. Perspektivwechsel werden durch die Konfrontation mit städtischer Heterogenität erleichtert und dadurch, dass unterschiedliche Blicke auf denselben Raum aufgezeigt werden, in dem die Lernenden ihre Situiertheit in der Welt sprichwörtlich erleben und durch andere Blickwinkel und Standpunkte erweitern können.

© Hannah Schilling/EAzB
Was enthüllt die Stadt?
Während des Seminars ging es viel um die Auseinandersetzung mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren, das sich im Erkunden der Stadt Berlin dem Menschen zeigt oder sich vor ihm verbirgt. Im räumlichen Lernen kann man mit Vordergrund und Hintergrund, Verborgenem und Exponiertem sehr spielerisch und auch konkret arbeiten. Deutlich wurde das im Rahmen eines lobbykritischen Stadtrundgangs von LobbyControl: Verschlossene Türen, die spürbar machen, wie machtvoll Räume sind; offene Plätze, die von vielen Augenpaaren erkundet werden und damit am Ende in der Auswertung jeweils ganz Unterschiedliches zum Vorschein bringen; Orte, die einem noch nie aufgefallen sind, obwohl man schon zehn Jahre in der Stadt lebt und tagein, tagaus an ihnen vorbeigekommen ist. Urbanität ist gekennzeichnet von Dichte, und in dieser Dichte verlieren sich Dinge, bleiben im Verborgenen, werden versteckt. Und wiederum andere treten in den Vordergrund, werden repräsentativ arrangiert und aktiv in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.
Als Knotenpunkte im globalen Kapitalismus sind Städte auch Kristallisationspunkte, an denen sich weltweite ökonomische Verflechtungen, die Konzentration von Reichtum und die bestehende (globale, aber eben auch lokal artikulierte) Ungleichheit besonders gut aufzeigen lassen – indem man verdeckte Interdependenz sichtbar macht. Mit der Konzentration ökonomischer Macht ist auch politische Gestaltungsmacht nicht weit, und so können Städte als Orte erkundet werden, in denen politische, ökonomische Macht und die Konflikte um Machtkonzentration besonders gut diskutiert werden können.
Die vielen Lobbybüros in unmittelbarer Nähe des Reichstagsgebäudes sind ein Beispiel dafür, dass Macht nichts Abstraktes ist, sondern dass es Menschen sind, die organisiert in Netzwerken Privilegien nutzen und schützen. Und diese Netzwerke brauchen konkrete Räume und (trotz digitaler Möglichkeiten) Gelegenheiten für Austausch in Präsenz. Politische Einflussnahme wird somit auch baulich und räumlich realisiert.
Diese Realität als Gruppen „live“ zu besuchen und vor den Klingelschildern zu stehen, die Cafés zu beobachten und die Atmosphäre mit allen Sinnen zu erfahren, zeigt: Die konkrete räumliche Erfahrung macht abstrakte Fragen um Macht greifbar und es entsteht viel unmittelbarer ein Bezug zum eigenen (Er-) Leben – und wenn es bloß die Erfahrung ist, vor verschlossenen Türen zu stehen.
Methodische Reflexion
Wollen wir die Potenziale von städtischen Räumen als Lernarrangements der politischen Bildung umfassend beschreiben, kann nicht der (Lern-) Ort allein betrachtet werden, sondern sollte das Zusammenwirken mit anderen Gestaltungsmerkmalen berücksichtig werden. Die Frage ist also auch, wie städtische Orte methodisch als physischer und sozialer Raum thematisiert und Teil von Lernarrangements werden können. Im Seminar erlebten wir u.a. politische Stadtrundgänge, lernten die Methode des „kollektiven kritischen Kartierens“ und der ethnographischen Beobachtung kennen.
Gemeinsam mit den Teilnehmenden entwickelten wir Beobachtungsfragen für eine systematische Analyse von didaktisch vorbereiteten Lernarrangements im Stadtraum. Im Fokus standen Fragen nach der Zugänglichkeit und nach Ausschlüssen von Orten, zu arrangierten Situationen und wie diese den Ort selbst performativ verändern. Auch erkundeten wir, inwiefern die Methoden vielseitige Lesarten von Räumen ermöglichen und diskutierten die Effekte davon.
Im Sinne einer machtkritischen politischen Bildung (semi-) öffentlicher Räume scheint ein Blick auf räumlich vermittelte Grenzen vs. Möglichkeitshorizonte sehr relevant. Vielversprechend ist es ebenso, den Teilnehmenden selbst die Aneignung und Resonanzerfahrung mit dem Raum zu ermöglichen, möglichst über mehrere Sinne. Räume aus ihrer Funktion als Kulisse und Hintergrund für Wissensvermittlung herauszuholen und stattdessen ihre Gestaltbarkeit, Vieldeutigkeit und Vermachtung zu vermitteln, ist demnach zentral für ein politisches Lernen in und mit der Stadt.
Dr. Hannah Schilling ist Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Dr. Oliver Emde ist Studienleiter für politische Jugendbildung & Pädagogik an der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Ihr Text erschien zuerst auf der Website der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung.
Erschienen am 30.07.2025
Aktualisiert am 31.07.2025