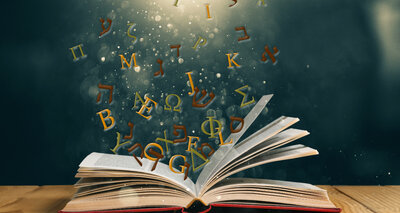Antisemitismuskritik und Israel
Orientierungshilfe für den Unterricht und in der Bildungsarbeit

© Anne Eichhorst/EAzB
Antisemitische Bilder und Mythen sind tief in den Köpfen und Herzen der Menschen verwurzelt und oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Überall – in den Medien, in der Popkultur oder in Schulbüchern – begegnen uns antisemitische Narrative. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Frage der Umsetzung von Antisemitismuskritik in der Bildung mit einer besonderen Dringlichkeit zu stellen und zu beantworten. Nicht erst seitdem ist zu beobachten, wie antisemitische Stereotype und Narrative auf Israel als Projektionsfläche übertragen werden, was wir israelbezogenen Antisemitismus nennen.
Die von der Evangelischen Akademie zu Berlin herausgegebene Orientierungshilfe „Antisemitismuskritik und Israel. Wie mach ich’s?“ soll in Kurzform Ansätze und Kriterien für eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit beschreiben. Sie ist gedacht als Prävention oder als Reaktion auf aktuelle Ereignisse und Debatten angesichts von Verunsicherungen, Fragen, vielschichtigen Betroffenheiten und auch aggressiven Auseinandersetzung in Schule und Gesellschaft. Ziel ist es, Werkzeuge und Perspektiven zu vermitteln, die befähigen, antisemitische Narrative zu erkennen, zu hinterfragen und konstruktive Gegenerzählungen zu entwickeln.
Tief verankerte antisemitische Bilder bewusst machen
Dabei geht es nicht darum, Schüler*innen des Antisemitismus zu überführen, sondern die meist unbewusst verankerten und sehr alten antisemitischen Bilder bewusst zu machen. Vor allem im Kontext von israelbezogenem Antisemitismus als vergleichsweise neuem Phänomen ist die Sensibilisierung für Kontinuitäten verschiedener Antisemitismusformen erkenntnisreich. Der Anspruch, verzerrte Bilder zu verlernen oder die versteckten Codes zu erkennen, ist aufgrund deren tiefer Verankerung eine vielschichtige Aufgabe, die einer selbstkritischen Haltung sowie selbstreflexiver Methoden bedarf. Beide sind in der gegenwärtigen polarisierten Debattenlage besonders schwierig, aber besonders wichtig: Inwiefern sind wir als Gesellschaft für Antisemitismus verantwortlich? Was hat mein Bild von Israel geprägt? Welche Informationen erhalte ich dazu oder nehme ich warum wahr? Welche inneren und äußeren Hindernisse gibt es, die den Umgang mit antisemitismuskritischen Inhalten erschweren? Welche antijüdischen Bilder sind Teil meines Denkens?
Antisemitismus dient der Selbstidealisierung und Selbstbestätigung durch die Abwertung von Jüdinnen und Juden oder dem Judentum. Um die Bedeutung des Antisemitismus zu verdeutlichen, bietet es sich in der pädagogischen Praxis an, die Tradierung und Kontinuitäten der Stereotype aufzuzeigen, z. B. das Bild des „geldgierigen Juden“ im Mittelalter, der „verschwörerischen Finanzelite“ in aktuellen Verschwörungserzählungen oder die Abwertung des „rachsüchtigen Judentums“ und des „gewaltvollen israelischen Soldaten“. Diese Projektions- und Delegationsmechanismen gilt es zu durchbrechen. Sie führen zu einer Dualisierung der Weltsicht. Im Vergleich mit den antisemitischen Bildern von den hartherzigen, rachsüchtigen, gesetzlichen, lieblosen, frauenverachtenden, kriegerischen Juden kann sich das Gegenüber, z. B. Christ*innen, zugewandt, liebevoll, solidarisch, aufgeklärt und progressiv fühlen. Aus Selbstbeschreibungen christlicher Identität in Abgrenzung zum Judentum lässt sich die zentrale Funktion des Antisemitismus nachvollziehen.
Die Orientierungshilfe für Lehrkräfte und pädagogische Multiplikator*innen beschäftigt sich mit israelbezogenem Antisemitismus und den Wirkungen von Verschwörungstheorien; sie beleuchtet Ansätze und Gegenerzählungen gegen die Reproduktion antisemitischer Bilder und Narrative. Die Verfasser*innen Kristina Herbst und Christian Staffa benennen Fallstricke bei der Thematisierung von Israel und bieten Reflexionsfragen zur Darstellung von Israel und zur Thematisierung von Antisemitismus, sowie – nicht zuletzt – Tipps zur pädagogischen Beschäftigung mit Antisemitismus und Israel nach dem 7. Oktober 2023.
Der Text entstand im Zuge des Akademieprojekts „Das Gerücht über die Juden“ und wurde gefördert aus Mitteln des „Aktionsfonds zur Unterstützung von Projekten gegen Antisemitismus“ der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Berlin.
Erschienen am 17.10.2025
Aktualisiert am 18.10.2025